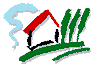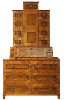|
|||||||||||||||||
| startseite — bau-Infos — bau-recht — forum — ofenbilder — bau-faq — bau-links — bau-tipps — impressum | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Welche Wirkung hat die Abnahme?
Der Auftraggeber ist nach § 640 Abs. 1 BGB bzw. § 12 Nr. 1 und 3 VOB/B verpflichtet, das im wesentlichen vertragsgemäß hergestellte Werk abzunehmen. Die Abnahme ist eine Hauptleistungspflicht des Bauherrn, auf die theoretisch "isoliert" geklagt werden könnte. Prozessökonomischer ist jedoch die sofortige Einforderung des Werklohns auf dem Klagewege. Befindet sich der Auftraggeber im Annahmeverzug, wird die Vergütung dennoch fällig. Im Rahmen des Verfahrens wird deshalb die Berechtigung der Abnahmeverweigerung inzident geprüft. Die Leistung des Auftragnehmers muss nach dem Maßstab des § 633 Abs. 1 BGB bzw. § 13 Nr. 1 VOB/B im wesentlichen (bis auf geringfügige Mängel oder Restarbeiten) erbracht und mit zugesicherten Eigenschaften versehen sein. Mit der Abnahme der Bauleistung durch den Bauherrn fällt gemäß § 641 BGB die Vorleistungspflicht des Bauunternehmers weg. Dies gilt nicht nur bei Vorliegen eines mangelfreien Werkes, denn die Abnahme einer Leistung bedeutet nur die Anerkennung des Werks als eine der Hauptsache nach vertragsgemäße Erfüllung (BGH 48, 257, 263). Daher schließen das Vorhandensein und selbst die Rüge von Mängeln grundsätzlich die Abnahme nicht aus. Weist die Bauleistung des Bauunternehmers allerdings noch Mängel auf, ist der Bauherr berechtigt, die Abnahme bis zu deren Beseitigung zu verweigern. Im Gegensatz zum BGB- Bauvertrag ist dies bei Vereinbarung der VOB/B jedoch nur möglich, wenn wesentliche Mängel vorliegen (§ 12 Nr. 3 VOB/B). Doch auch das Abnahmeverweigerungsrecht bei dem Bauvertrag nach BGB kann entfallen, wenn es der Bauherr auf einen ganz unbedeutenden Mangel stützt und sich die Verweigerung der Abnahme deshalb als ein Verstoß gegen Treu und Glauben darstellen würde. Eine Klausel in AGB, die das Recht der Abnahmeverweigerung auf wesentliche Mängel beschränkt ist bedenklich, da sie von wesentlichen gesetzlichen Grundgedanken abweicht. Urteil
des BGH, NJW 1996, S. 1280: Urteil
des OLG Düsseldorf, BauR 1997, S. 842: Urteil
des OLG Celle, BauR 1997, S. 1049: Eine wirksame Abnahme setzt dabei in der Regel einerseits die reale "körperliche" Entgegennahme des Werkes voraus. Andererseits bedarf es für deren Annahme auch der "geistigen" ausdrücklichen oder stillschweigenden Billigung. Die Voraussetzung dieser zwei Bestandteile ist auch gerechtfertigt, da das Gesetz an die erfolgte Abnahme verschiedene wichtige Rechtsfolgen knüpft, die billigerweise nur dann eintreten dürfen, wenn Entgegennahme und Billigung zusammentreffen. Mit der Abnahme wird die Vergütung fällig (§ 641 BGB). Der Erfüllungsanspruch des Bauherrn beschränkt sich dann auf das konkret abgenommene Werk. Zugleich beginnt mit der Abnahme der Lauf der Verjährung für die Gewährleistungsansprüche (§ 638 Abs. 1 S. 2 BGB bzw. §13 Nr. 4 Abs. 3 VOB/B). Dies ist jedoch nur dann gerechtfertigt, wenn die Bauleistung im wesentlichen als vertragsgemäß anerkannt wurde. Darüber hinaus ändert sich die Regelung der Gefahrtragung. Die Gefahr eines Untergangs des Werkes geht mit der Abnahme auf den Auftragnehmer über (§ 644 Abs. 1 S. 1 BGB bzw. § 12 Nr. 6 VOB/B). Er sollte deshalb die Verfügungsgewalt über das Werk innehaben. Urteile
des BGH, NJW 1997, S. 3018; NJW 1998, S. 456: Da der Bauherr durch die Abnahme zu erkennen gibt, dass er das Werk des Bauunternehmers im wesentlichen billigt, findet in diesem Moment eine Umkehr der Beweislast statt. Dies bedeutet, dass der Auftragnehmer mit diesem Zeitpunkt von seiner Pflicht, die Mangelfreiheit nachzuweisen, befreit wird. Von nun an ist es Sache des Auftraggebers, das Vorhandensein behaupteter Mängel zu beweisen. Auch wenn Beweislastentscheidungen in der gerichtlichen Praxis des privaten Baurechts aufgrund der erreichbaren Qualität der Gutachten nahezu ausgeschlossen sind, erlangt die Beweislast zumindest bei der Frage, wer den Kostenvorschuss für den Sachverständigen zu verauslagen hat, eine durchaus beachtenswerte Bedeutung. Die Abnahme führt im übrigen jedoch zu keinem Rechtsverlust des Bauherrn. Der Bauunternehmer ist weiterhin zur Beseitigung von Mängeln verpflichtet. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Auftraggeber hinsichtlich bei Abnahme bekannter Mängel keinen Vorbehalt erklärt (§ 640 Abs. 2 BGB, bzw. gemäß § 12 Nr. 5 Abs. 3 VOB/B unter Befristung). Ein Rechtsverlust tritt allerdings nur bei positiver Kenntnis ein, fahrlässige Unkenntnis ist dafür nicht ausreichend. Daneben bleibt das Recht, Schadensersatz zu beanspruchen, in jedem Fall erhalten. Die Abnahme und damit die Anerkennung der Bauleistung kann ausdrücklich, aber auch konkludent (stillschweigend) erfolgen. Das Gesetz sieht für die Abnahme keine bestimmte Form vor; sie kann jedoch zwischen den Parteien vertraglich vereinbart werden. Nach § 641 Abs. 1 S. 2 BGB bzw. § 12 Nr. 2 VOB/B sind auch Teilabnahmen möglich. Eine Pflicht hierzu besteht bei Vereinbarung der VOB/B, bei dem Bauvertrag nach BGB muss sie sich aus dem Vertrag ergeben. Eine ausdrückliche Abnahme kann z.B. im Rahmen einer förmlichen Abnahme (mit gemeinsamer Prüfung und Erstellung eines Protokolls) stattfinden. Bei Vereinbarung der VOB/B kann jede Vertragspartei eine förmliche Abnahme verlangen (§ 12 Nr. 4 Abs. 1 VOB/B), bei dem Bauvertrag nach BGB muss diese Form dagegen zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart werden. Für eine ausdrückliche Abnahme reicht ansonsten aber auch bereits eine mündliche oder schriftliche Erklärung des Bauherrn oder seines Stellvertreters (beispielsweise: man ist mit der Bauleistung "einverstanden", diese ist "in Ordnung", man ist "zufrieden", o.ä.). Dagegen liegt noch keine Abnahme vor, wenn der Auftraggeber nur eine vorläufige Erklärung abgibt und sich die weitere Überprüfung und endgültige Abnahme nach Mangelbeseitigung vorbehält. Eine konkludente Abnahme ist immer dann gegeben, wenn der Bauherr durch sein Verhalten zum Ausdruck bringt, dass er das Werk im wesentlichen als vertragsgerecht ansieht (beispielsweise: durch die vorbehaltlose Zahlung des restlichen Werklohns, die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme oder den Bezug, die Auszahlung des Sicherheitsbetrages, die Veräußerung des Bauwerks, o.ä.). Urteil
des BGH, BauR 1999, S. 1186: Urteil
des OLG Düsseldorf, BauR 1998, S. 126: Urteil
des OLG Celle, BauR 1997, S. 844: Urteil
des OLG Koblenz, BauR 1997, S. 482: Wurde die VOB/B als Ganzes wirksam vereinbart, kann daneben eine Abnahmefiktion nach Ablauf der Fristen des § 12 Nr. 5 Abs. 1 und 2 VOB/B eintreten. Die Übersendung der Schlussrechnung gilt dabei nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes als schriftliche Mitteilung der Fertigstellung der Leistung (so schon BGH, BauR 1971, S. 126). Diese Wirkungen können allerdings in ABG wirksam ausgeschlossen werden, da sie nicht zum Leitbild des gesetzlichen Werkvertragsrechts gehören (siehe BGH; BB 1997, S. 176). Außerdem greift die Abnahmefiktion dann nicht ein, wenn der Auftraggeber seinen Willen, die Abnahme zu verweigern, bekundet hat (OLG Celle, BauR 1997, S. 1049). Wurde die Bauleistung weder ausdrücklich, noch konkludent abgenommen, können auch Abnahmesurrogate deren Wirkungen herbeiführen. Dies gilt etwa für die unberechtigte Verweigerung der Abnahme. Verweigert der Auftraggeber beispielsweise die Abnahme, gestattet dem Auftragnehmer aber keine Vollendung seiner Leistung und rechnet mit Gegenansprüchen wegen angeblicher oder wirklicher Mängel auf, dann hat dieses Verhalten zur Folge, dass die Abnahme als eingetreten gilt, jedenfalls bezüglich der Fälligkeit des Werklohns. Aus ähnlichen Gründen kann sich der Auftraggeber dann nicht auf das Fehlen der Abnahme berufen, wenn er sich diesbezüglich im Verzug befindet. Da die Abnahme Hauptpflicht des Auftraggebers ist, kann er durch Mahnung oder unberechtigte Verweigerung in Leistungsverzug kommen. Bei dem Bauvertrag nach BGB bietet sich in diesem Zusammenhang die analoge Anwendung der 12-Werktagefrist des § 12 VOB/B an. Dem Auftraggeber kann diese Frist bereits mit der Aufforderung zur Abnahme gesetzt werden, so dass er nach ergebnislosem Ablauf in Annahmeverzug gerät. Der Auftraggeber kann den Verzug jedoch durch Erhebung einer Mangeleinrede beseitigen, wenn die Rüge auch eine Abnahmeverweigerung rechtfertigt. Diesbezüglich ist die Rechtslage deutlich anders als bei der Fiktion der Abnahme bei vereinbarter VOB/B. Quelle:
Stefan Fischer, Rechtsanwalt |
|
|||||||||||||||